Herzlich Willkommen bei cooperatio
In gemeinsamer Arbeit von Sozialpädagog_innen und Lehrer_innen ist eine Initiative entstanden,
die Konzepte zur Sozialen Arbeit im Bildungsraum Schule formuliert, umsetzt und weiter entwickelt.
Wir möchten Sie hier über die Ziele und Aktivitäten
des "cooperatio – Soziale Arbeit und Schule e.V." in Dresden informieren.
Aktuelle Projekte finden Sie hier»
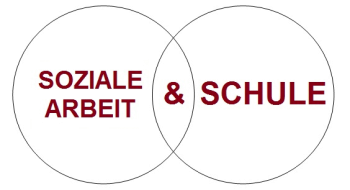
Für Fragen und Hinweise stehen Ihnen die Mitglieder des Vereins gern zur Verfügung.
Bitte nehmen Sie bei Interesse Kontakt zu uns auf.
Aktuelles
Wir wünschen allen einen gelungenen und angenehmen Start ins neue Schuljahr.
